Karl Valentin: Im Hutladen
- michaelsienhold
- 1. Apr.
- 3 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 11. Dez.

Die folgenden vier Zeilen sind ein Auszug aus dem gleichnamigen komischen Dialog zwischen Liesl Karlstadt und Karl Valentin. Sie gibt die Verkäuferin, er den Kunden. Diese Sequenz ist symptomatisch für den ganzen Dialog.
…
Karlstadt: Also nun müssen Sie sich aber bald entschließen, was Sie für einen Hut wollen.
Valentin: Einen neuen Hut.
Karlstadt: Ja wir ham ja nur neue.
Valentin: Ich will ja einen neuen.
…
Die Grundstruktur der Sequenz ist, dass Valentin logisch anschlussfähig auf den wörtlichen Gehalt von Karlstadts Äußerungen antwortet, seine Antworten aber nicht die Erwartungshaltung erfüllen können, die Karlstadt durch sie an ihn heranträgt. Sie versucht ihn eine Huteigenschaft nennen zu lassen, die nicht alle angebotenen Hüte haben, um die Erfüllung ihrer Erwartungshaltung zu initiieren, dass er eine Kaufentscheidung treffen wird.
Ihre Erwartungshaltung ist berechtigt, weil sie Verkäuferin in einem Hutgeschäft ist und es betretende Kunden in der Regel zu Recht als im Wissen darum zu behandeln sind, dass von ihnen zu erwarten ist, einer Kaufentscheidung dienlich zu handeln, wenn sie ein Gespräch mit ihr eingehen und nicht sagen, sich nur umschauen zu wollen. Ein Gespräch mit ihr geht Valentin gleich nach seinem Ladeneintritt ein.
Mit seiner ersten Antwort, einen neuen Hut zu wollen, beschränkt sich Valentin noch darauf, Karlstadt die Erfüllung ihres Versuchs zu verwehren, ihr eine Huteigenschaft zu nennen, die nicht alle Hüte haben, um eine Kaufentscheidung auf den Weg zu bringen. In seiner zweiten Antwort ich will ja einen erzeugt er zudem eine Fiktion darüber, was Karlstadt mit ihrer zweiten Äußerung ja wir ham ja nur neue tat.
Mit ihr gab sie ihm ein berechtigtes Widerwort. Mit ihr beanspruchte sie nämlich, dass es auch gebrauchte und nicht nur neue Hüte im Laden geben würde, wenn seine Antwort, einen neuen zu wollen, adäquat gewesen wäre. Dann hätte sie einer Kaufentscheidung dienlich sein können. Da sie aufgrund des Kontexts der Verkaufssituation berechtigt beansprucht, dass seine Antwort einer Kaufentscheidung dienlich sein zu können hat, erwidert sie zu Recht damit, nur neue Hüte zu haben, weil dies dies ausschließt.
Valentin wäre nicht Valentin, wenn er nun anerkennen würde, dass ihre Erwiderung berechtigt war. Stattdessen suggeriert er mit seiner zweiten Antwort ja einen neuen zu wollen, dass sie ihn in seinem zu haben bekundeten Wunsch mit ihrer Aussage ja nur neue Hüte zu haben zu enttäuschen gemeint hätte. Als hätte sie damit nicht die Sinnlosigkeit seiner Antwort für das Finden einer Kaufentscheidung offenbart, sondern die Vorstellung zum Ausdruck gebracht, er wolle keinen neuen.
Es ist besonders widersinnig, dass er ihr attestiert, sie hätte ihn mit ihrer Antwort enttäuschen zu müssen geglaubt. Hat er ihr doch unmittelbar davor bekundet, einen neuen Hut zu wollen, von dem er sie nun – dem Eindruck nach – meinen lässt, dass er ihn nicht wolle. Damit diskreditiert er sie, stellt er so doch in den Raum, dass sie ihm nicht zugehört habe oder seine Wunschbekundung nicht für die Tatsächlichkeit des Bekundeten sprechend anerkenne. Letzteres ist ein massiver Vorwurf, weil wir es zumeist als dem Vorwurf der Lüge gleichkommend beurteilen, zu beanspruchen, dass eine Wunschbekundung in der ersten Person nicht für ihre Wahrheit spreche. Wir müssen doch wissen, was wir wollen, sodass wir wissen, das Gegenteil dessen zu wollen zu behaupten, was wir wollen, wenn wir etwas zu wollen behaupten, was wir nicht wollen.
Er hätte die Erfüllungswürdigkeit ihrer Erwartungshaltung, dass sie einer Kaufentscheidung dienlich zu interagieren haben, z. B. dadurch anerkennen können, zu sagen, dass er bis vor ihrer zweiten Aussage ja nur neue Hüte zu haben noch fälschlich geglaubt habe, dass sie auch gebrauchte verkaufe. Dann hätte er die Erfüllungswürdigkeit ihrer Erwartungshaltung dadurch anerkannt, ihre Nichterfüllung zu begründen. Schließlich drückt sich unsere Bindung an eine Erwartung in der Regel darin aus, ihre Nichterfüllung zu begründen.
Dann hätte er sich aber fast schon selbst dazu verpflichtet, von nun an auf eine Weise zu handeln, von der man berechtigt glauben kann, dass sie dieser Erwartungshaltung genüge. Er könnte zwar auch dann weitere Falschglauben über das Hutangebot zu haben behaupten, mit denen er wieder begründen könnte, warum er die Erwartungshaltung mit weiteren – sie nicht erfüllenden – Antworten zu erfüllen glaubte. Aber er käme dann nicht mehr daran vorbei, anzuerkennen, dass seine Antworten sie zu erfüllen haben. Und genau das tut er nicht.

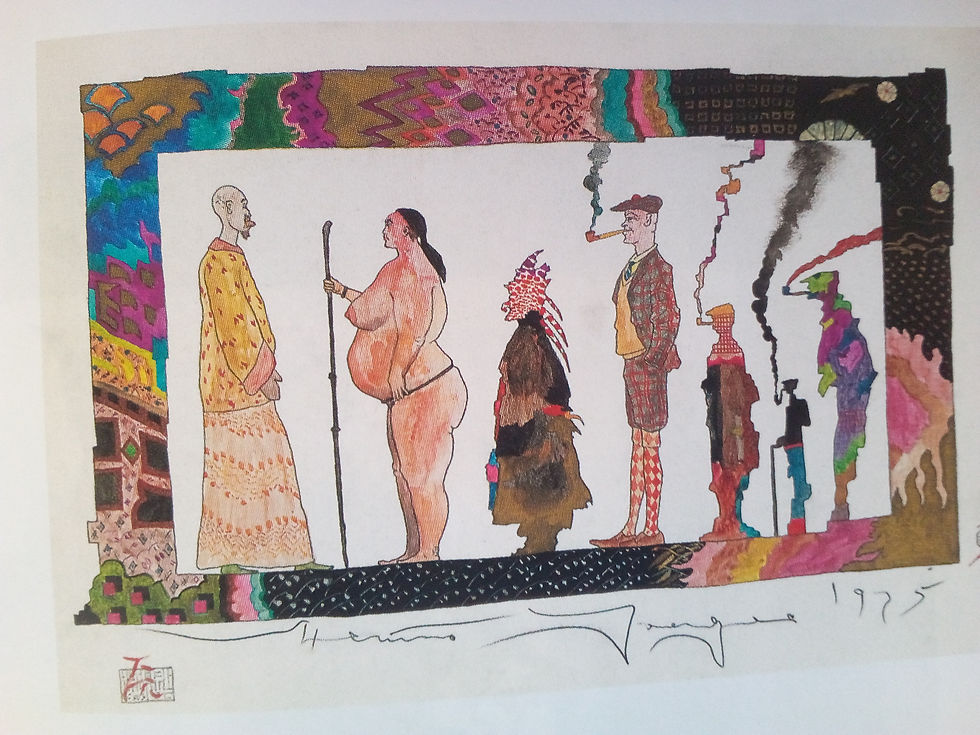

Kommentare