Heino Jaeger: Der Kakaobaum
- michaelsienhold
- 28. Aug.
- 11 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 26. Okt.
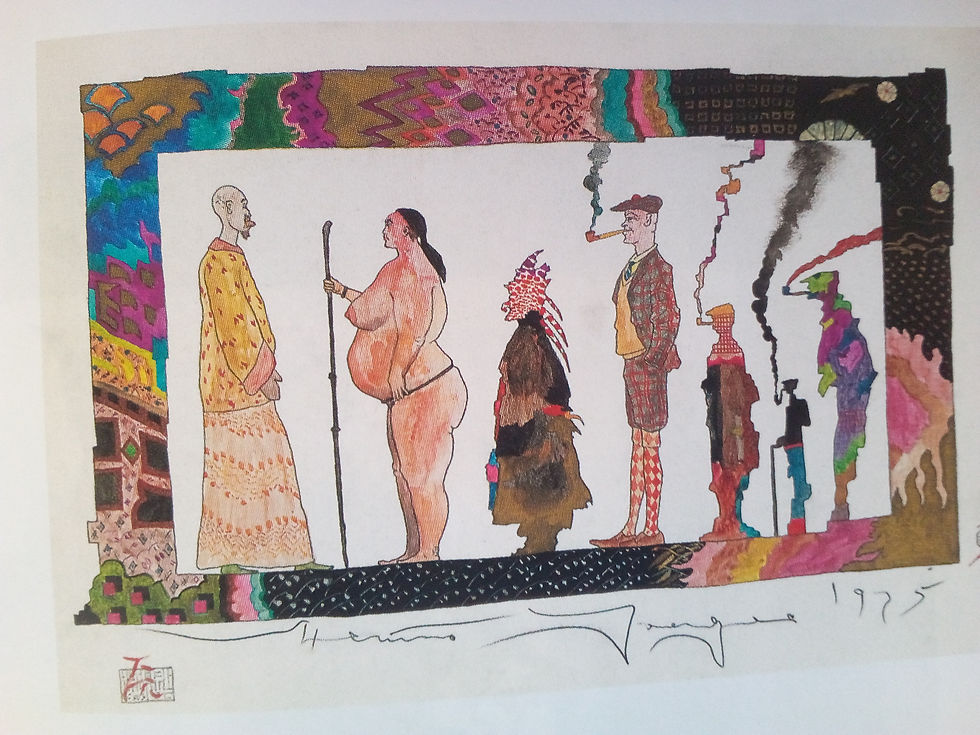
Werk:
Der Kakaobaum ein indianischer Baum ist überall am Amazonas anzutreffen. Um mit ihm Bekanntschaft zu machen bestiegen wir in äh Costa däh della Chalga ein schmales Boot. Unser Begleiter Hachera de Kote sagte uns in gutem Wienerisch äh paquillium para quanté pa- para quanté das heißt so viel wie guten Tag wie geht’s es kann aber auch ä übermorgen äh bedeuten aber das nur am Rande. Und so kamen wir mit unserem äh äh Forschungen mit unserem Kamerateam dort an wo wir ohnehin nicht hin wollten nach Sira della Keto Stadt ohne Licht. Als wir dort ankamen ich und nicht zuletzt mein Assistent Sir Herr Bubholz wir fanden eine chaotische nach äh übrigens äh typischer indianischer Bauart n’äh vor äh aus einer der dieser Hütten wo uns ein Gott zahnloses Mütterchen wie mir schien äh zurief äh Qienka Quienka. Wir fanden also ein typisch indianisches äh Dorf vor aber keine Kakaobäume. Und so kam es dann dass man uns sagte geht woanders hin äh also Quink- Quienka Quienka wie wir später mal mit b- äh mit Begleiter in gutem spätenglischen Akzent parie- heiß hieß das hier äh gibt es nichts. Nun der Kakaobaum wie hier in der äh khemischen Analyse ist überall dort vor- vorzufinden wo der Inkabaum übrigens ein aus Khina eingeführter den Alkeljas der äh Südkordoljeren nicht unähnlichen Stauden sehen wir hier auch sehr schön äh in der Aufnahme die eine Höhe von äh mehreren Metern der viel Licht braucht. Wir haben diesen Baum dann wiedergetroffen an der Sierra della Brava und vor allen Dingen äh hieß es Gua Guajana Guajana heißt so viel wie äh übermorgen in einem Land zwischen gestern und morgen
(gesprochen: https://www.youtube.com/watch?v=oRrm9EEO0UI)
Analyse:
Jaeger lässt hier einen Forschungsreisenden von seiner Expedition erzählen, auf der er den Kakaobaum erforscht habe. Gleich die erste Sequenz enthält eine Merkwürdigkeit. In ihr sagt er nämlich, dass man den Baum überall im Amazonas antreffen könne, wo wir in der Regel sonst doch nur vom Antreffen reden, wenn das Angetroffene eine Person ist. Diese fragwürdige Personalisierung des Verhältnisses zum Kakaobaum setzt er dann fort, indem er sagt, dass das Expeditionsteam ein schmales Boot bestiegen habe, um Bekanntschaft mit dem Baum zu machen. Dass sie dies dafür tun mussten, passt nicht ins Bild, hatte der Erzähler doch gerade gesagt, dass der Kakaobaum überall am Amazonas zu finden sei.
Ungebremst absurd wird es, als Jaeger den Erzähler sagen lässt, dass der Begleiter der Expedition (Hachera de Kote) sich in einer in Südamerika gesprochen wirkenden Sprache (paquillium para quanté pa- para quanté) in gutem Wienerisch an sie gewendet habe. So ist es zwar möglich, dass jemand mit Wiener Dialekt eine solche Sprache spricht, aber mehr als fragwürdig, dabei die Qualität des Dialektalen und nicht des Sprechens der gesprochenen Sprache zu beurteilen, wie es der Erzähler hier macht. Fragt sich doch, ob die Güte eines Dialekts überhaupt sichtbar werden kann, wenn er sich – wie hier – nicht im Sprechen seiner Muttersprache zeigt. Vernünftig gewesen wäre es zu sagen, dass der Begleiter mit Wiener Dialekt gut die entsprechende Sprache gesprochen habe. Ferner ist es erklärungsbedürftig, warum jener überhaupt mit wienerischer Färbung gesprochen habe, ist doch bisher mit keiner Silbe Bezug zu Österreich hergestellt worden. Es hat aber auch ohnehin keinerlei erkennbare Relevanz fürs Erzählen der Expeditionsreise, die dialektale Färbung des Expeditionsbegleiters mitzuteilen. So muss dies etwas anderem geschuldet sein – nämlich dem Profilierungsdrang des Erzählers. Er wollte vermitteln, dass er gutes Wienerisch erkenne. Diesen Profilierungsdrang setzt er weiter fort, indem er sich jener in Südamerika gesprochenen Sprache mächtig seiend gibt und die von ihm zitierten Aussagen übersetzt. Vollends offenbar, dass es dem Erzähler nur um seine Selbstprofilierung geht, macht es Jaeger dadurch, dass er ihn alltäglichste Sprachhandlungen – eine Begrüßung und eine die gemeinsame Bootfahrt zeremoniell eröffnende Frage nach dem Wohlbefinden – wörtlich zitieren lässt. Sind von einem Expeditionsbericht doch gerade nicht solche Alltäglichkeiten, sondern außergewöhnliche Erfahrungen zu erwarten. Dieses Schildern von Alltäglichkeiten lässt ihn Jaeger zudem noch mit einer Alternativübersetzung (das Zitierte könne auch übermorgen bedeuten) garnieren, um seine Selbstprofilierung fortschreiten zu lassen. Vom Relevanz-Anspruch auf diese andere Übersetzung lässt Jaeger ihn sich dann allerdings distanzieren, indem er ihn sagen lässt, dass sie nur als beiläufige Bemerkung aufzufassen sei. Das ist jedoch keineswegs rehabilitierend, versucht er mit dieser Distanzierung doch darüber hinwegzutäuschen, dass schon auf die wörtliche Wiedergabe der Alltagshandlungen zu verzichten gewesen wäre. Auch fragt sich, ob es richtig war, die Alternativübersetzung überhaupt mitzuteilen, wenn er sie dann doch als Randbemerkung abtut. Fürs Erzählen besser wäre es wohl gewesen, entweder zu ihr zu stehen und sie nicht als solche abzutun oder sie gar nicht erst zu treffen.
Der Erzähler fährt damit fort zu sagen, dass sie da ankamen, wo sie ohnehin nicht hin wollten. Das ist eine tiefe Absurdität, die nicht leicht zu fassen ist. Hätte er die Verneinung weggelassen, also gesagt, dass sie sowieso – also mit der Bootsfahrt nicht gerechnet habend – dort hin wollten, wäre sie nicht derart komisch. Dann hätte man sich als Zuhörer lediglich gefragt, warum der Erzähler nicht schon mitgeteilt hat, dass die Bootsfahrt eigentlich nicht geplant gewesen sei. Aber was macht nun die getroffene Aussage so komisch? Dass man überhaupt da hin fährt, wo man nicht sein will, macht man es doch in der Regel genau deshalb nicht. Auch legt die Aussage die Vorstellung nahe, die Bootsfahrt könnte eigens dafür gesorgt haben, dass man nicht mehr dort habe sein wollen, wo man vor Beginn der Fahrt noch habe sein wollen. Das Vorgestellte wäre nicht komisch, aber doch zu erklären, statt zu unterstellen gewesen. Er unterstellt es, indem er es gleich entkräften zu müssen meint, indem er diese Verneinungsaussage trifft und damit vermittelt, dass sie auch vor der Fahrt schon keine Lust auf den Ort hatten. Dann fragt man sich wiederum, warum sie überhaupt an jenen Ort gefahren sind, dürften sie doch willentlichen Einfluss darauf gehabt haben, wohin sie fuhren. Auffallend ist auch, dass er den Satz, in dem er diese Verneinungsaussage trifft, damit beginnt, dass sie mit ihren Forschungen an jenen Ort – an dem sie nicht sein wollten – gekommen seien: Als wären sie zu unentdecktem Land auf der Erde vorgedrungen. Dann schwenkt er in der adverbialen Bestimmung des Satzes von mit unseren Forschungen auf mit unserem Kamerateam um, mit dem sie an jenem Ort angekommen seien. Jaeger könnte ihn sich zu diesem Wechsel genötigt sehend inszeniert haben, weil er ihn unmittelbar danach den Namen der Stadt sagen wollen lässt, wodurch er nicht länger an seiner Fantasie festhalten wollen konnte, dass es unentdecktes Land war, dürfte solches doch (noch) keinen Namen getragen haben können. Bei aller Tristesse, an einen Ort gefahren zu sein, an dem sie nicht sein wollten, lässt es sich der Erzähler aber nicht nehmen, wieder den Eindruck zu erzeugen, über profunde Sprachkenntnisse zu verfügen, übersetzt er doch den Namen der Stadt ins Deutsche. Ihr übersetzter Name, Stadt ohne Licht, passt dann wenigstens dazu, dass sie dort nicht haben sein wollen.
In der nächsten Sequenz schildert sich der Erzähler selbst zuerst nennend in der genannten Stadt angekommen zu sein; neben seinem Assistenten Bubholz, auf den er sich mit dem englischen Adelsprädikat Sir zu beziehen beginnt, ehe er ins Deutsche wechselt, ohne einen entsprechenden Adelsausdruck zu verwenden. Ein anderer Grund für die Äußerung des Adelsprädikats als die Fantasie, einen Adligen zum Assistenten zu haben, dürfte hier kaum bestanden haben können. Er könnte sich höchstens noch ob seiner (in seiner Wunschvorstellung) häufigen Beziehungen mit adligen Briten zu ihr geneigt gewesen seiend geben. Merkwürdig ist auch, wie er die Mannstärke des Expeditionsteams bestimmt. Er bestimmt nur, dass es mehr als zwei Personen gewesen seien, nicht aber, wie viel genau. Er beginnt nämlich mit Aufzählen und läutet bereits vor Nennung der zweitgenannten Person (Bubholz) dessen Abschluss ein, indem er ihr nicht zuletzt voranstellt. Er hätte sie wohl kaum da schon abgeschlossen, wenn noch allerhand mehr Person dabei waren. Er wollte nicht nichts über Teamgröße sagen, aber zugleich auch nichts Falsches oder die Bedeutung der Expedition Schmälerndes. Ihm erschien es für einen Moment attraktiv, die Teilnehmer aufzuzählen, ehe er sah, dass dabei die seine Selbstprofilierung gefährdende geringe Teilnehmerzahl zutage getreten wäre, was er dann damit abwendet, die Aufzählung kurz vor ihrer Vollständigkeit abzuschließen, um die Suggestion eines großen Expeditionsteams nicht ganz aufgeben zu müssen. Die Aufzählung mit der namentlichen Nennung von Bubholz und auf andere Expeditionsteilnehmer anonym verweisend abzuschließen, erzeugt auch den „Kollateralschaden“, jene Bubholz gegenüber abzuwerten, nennt er doch nur ihn – und nicht sie – namentlich. Die wenigen Expeditionsteilnehmer alle namentlich zu nennen, fiel seinem Selbstprofilierungsdrang zum Opfer, hätte es doch die Kleinheit der Expedition offenbart.
In der Stadt ohne Licht haben Bubholz und er dann eine dieser chaotischen Hütten in typischer indianischer Bauart vorgefunden. Diese Aussage wirkt seltsam, legt vorfinden nämlich nahe, dass das Vorgefundene am Ort des Vorfindens Seltenheitswert hat, so sagt er doch hier, dass sie eine Hütte in einer mutmaßlich hauptsächlich aus Hütten bestehenden Ansiedlung vorfanden. Dass die Hütte typisch indianischer Bauart gewesen sei, greift er als nebenbei erwähnt auf, indem er diesem Aussageteil übrigens voranstellt. Das ist deplatziert, weil sich diese Information nicht von den Informationen der sonstigen Bestandteile der Erzählung unterscheidet, die er nicht als nebensächlich markiert. An dieser Sequenz ferner bemerkenswert ist, dass er diese von ihm als Nebeninformation behandelte Charakterisierung der Hütte vollzieht, bevor er überhaupt bestimmt hat, was das Charakterisierte (die Hütte) ist. Die sich aus seiner Sicht über die Nennung der Nebeninformation bietende Gelegenheit zur Selbstprofilierung hat wohl so eine Anziehung auf ihn ausgeübt, dass die Nachvollziehbarkeit der Erzählung auf der Strecke blieb.
Dann habe ihnen, dem Expeditionsteam, ein seinem damaligen Eindruck nach (wie mir schien) zahnloses Mütterchen Quienka Quienka zugerufen. Mit dieser Aussage greift der Erzähler eigens die Möglichkeit auf, dass es ihm bloß so erschien, dass das Mütterchen zahnlos war. Das ist hochgradig absurd, weil es uns – eingedenk dessen, es nicht allzu genau zu nehmen zu haben – schwerlich nur so vorkommen kann, dass jemand keine Zähne hat. Wenn man es genau zu nehmen hätte, könnte man berechtigt darauf aufmerksam machen wollen, dass das Mütterchen durchaus Zähne gehabt haben könnte, diese aber durch ihre Wangen verdeckt nicht sichtbar waren. Da wir es nun aber dafür, wie wir die Aussage zu verstehen haben, nicht darauf ankommend zu behandeln haben, ob sie tatsächlich gar keine Zähne hatte, ist es skurril, dass der Erzähler es hier eigens darauf ankommend behandelt und auf die mögliche Kluft zwischen Erscheinung und Realität verweist. Das passt zum bekannten Muster, wie sehr sein Handeln von Profilierungsdrang und wie wenig von Vernunft bestimmt ist. Meint er besonders schlau zu sein, sich dieses möglichen Unterschieds bewusst seiend zu zeigen, so ist er im Zusammenhang der Erzählung doch bedeutungslos. Als stünde und fiele die Qualität der Expeditionserzählung damit, ob er sich die vollständige Zahnlosigkeit des Mütterchens nicht zu behaupten zeigt, wenn er sich auf es als ein zahnloses bezieht.
In der nächsten Sequenz sagt er, dass sie also ein typisch indianisches Dorf vorfanden, aber keine Kakaobäume. Zu sagen, dass sie also ein Dorf vorfanden, ist seltsam, wurde die Ansiedlung zuvor doch als Stadt (Stadt ohne Licht) bestimmt, sodass das hier Gesagte – entgegen dem, was also vermittelt – keineswegs aus dem zuvor Gesagten hervorgeht. Wenn „Stadt“ nur ein Eigenname für ein Dorf war, dann hätte der Erzähler das zu sagen gehabt, um die nun aufgekommene Irritation, ob Stadt oder Dorf, zu vermeiden. Die Bestimmtheit, mit der er zuvor die Ansiedlung Sira della Keto heißend aufgriff, vermittelte auch nicht gerade Provinzialität, sondern überregionale Bekanntheit. Im zweiten Teil der gerade untersuchten Aussage sagt er, dass sie in jenem Dorf keine Kakaobäume vorfanden. Das ist sehr komisch, wird so doch abermals deutlich, dass der Kakaobaum keineswegs überall am Amazonas zu finden war, wie er es zu Beginn der Erzählung vollmundig sagte.
Dann sei es so gekommen, dass man ihnen gesagt habe, dass sie woanders hingehen sollen – meinend, dass die bereits erwähnten Ausrufe des zahnlosen Mütterchens Quienka Quienka das bedeutet haben. Die Identität der Sprachhandlung des Mütterchens ihrer Äußerungsgestalt so nachgelagert zu bestimmen, ist merkwürdig, ist sie doch die wichtigste Information in dem Zusammenhang. Dass das Mütterchen sie fortgeschickt hat, ist zugleich auch urkomisch, weil es die Größenfantasie des Erzählers, in einer bedeutsamen Expedition mit Einheimischen in ihrer Sprache in Kontakt getreten zu sein, an der Realität zerschellen lässt. Das macht wiederum verständlich, warum er die Übersetzung ihrer Ausrufe ins Deutsche so lange aufgeschoben hat, hätte er seine Größeninszenierung sonst doch gar nicht erst aufnehmen können. Und dass er den Bezug auf das Ereignis, dass das Mütterchen sie fortschickte oder gar wegjagte, durch und so kam es dann als einen Bezug auf ein noch nicht in Bezug genommenes Ereignis behandelt, wo er es doch schon qua der Nennung ihrer Ausrufe geschildert hat, unterstreicht seinen Wunsch, es von seiner eigentlichen Identität, abgewiesen worden zu sein, zu lösen. Dann habe ihnen ihr Begleiter in gutem spätenglischen Akzent die Ausrufe des Mütterchens mit hier gibt es nichts zu bedeutend übersetzt. Auch das ist in mehreren Hinsichten komisch. Zum einen spezifiziert er erneut die Qualität einer sprachlichen Einfärbung im Sprechen einer Sprache, die nicht die Muttersprache der Einfärbung ist. War es zuvor das gute Wienerisch im Sprechen einer in Südamerika gesprochenen Sprache, so ist es jetzt der gute spätenglische Akzent im Deutschsprechen. Zum anderen ist es dieselbe Person, nämlich der Expeditionsbegleiter, von dem er zuvor gesagt hat, dass er gut Wienerisch gesprochen habe und nun sagt, dass er gut Spätenglisch gesprochen habe. Beides gut zu sprechen, ist zwar möglich, aber wohl kaum einer Erwähnung in einer Erzählung über eine Expedition am Amazonas würdig. Dient es doch nur der Selbstprofilierung des Erzählers, sich eines Erkennens jener Sprachnuancen fähig zu geben. Obendrein ist auch der Verweis auf die Übersetzung des Begleiters überflüssig, steht das Übersetzte (hier gibt es nichts) doch für genau das, was er das Mütterchen mit jenen Ausrufen bereits getan zu haben sagte – nämlich, sie weggeschickt (weggejagt) zu haben.
Nachdem nun deutlich geworden ist, dass sie den Kakaobaum immer noch nicht gefunden hatten, doziert er wieder über dessen Auffindbarkeit. Jetzt stellt er sie obendrein in Zusammenhang zu einer chemischen Analyse, die er dadurch, wie hier in der chemischen Analyse zu sagen, als bereits in die Erzählung eingeführte behandelt, wo er sie doch noch mit keiner Silbe erwähnt hat. Das Dozieren setzt er wo der Inkabaum sagend fort, was nahelegt, dass er damit zu sagen beginnen wollte, dass der Kakaobaum überall dort zu finden sei, wo der Inkabaum zu finden ist. Tatsächlich vollendet er den Satz aber nicht, sondern beginnt stattdessen unabhängig vom Kakaobaum über den Inkabaum zu dozieren: Dass er aus China eingeführt worden und einem anderen Gewächs nicht unähnlich sei. Dass er dieses Nebengleis aufmacht, lässt sich als Ausflucht vor der niederschmetternden Realität deuten, den eigentlichen Forschungsgegenstand – den Kakaobaum – immer noch nicht gefunden zu haben. Dann lässt ihn Jaeger noch Bezug zu fotografischen Aufnahmen von jenen anderen Pflanzen bzw. Bäumen herstellen. Das stellt nun zwar nicht zwingend einen Erzählungsbruch dar, weil man es nicht explizit sprachlich einzuführen hat, dass man Bilder zeigt, wenn man solche zeigt. Das ist dann selbstredend. Allerdings entbehrt auch diese Sequenz nicht der Komik, weil das Zeigen von Aufnahmen anderer Gewächse in einer Erzählung über eine Expedition zum Zwecke der Erforschung des Kakaobaums unerbittlich daran denken lässt, dass sie den eigentlichen Forschungsgegenstand nicht gefunden haben und daher auch nichts aus eigener Erfahrung über ihn sagen können.
Zum Abschluss lässt es Jaeger zur Konfusion darüber kommen, worüber der Erzähler zu berichten meint, indem er ihn von diesem Baum sprechen und den Zuhörer dabei im Unklaren lässt, welchen er meint. Meint er den Kakaobaum, den Inkabaum oder gar einen anderen? Dabei lässt er den Erzähler die Relation des Expeditionsteams zu jenem Baum wie zu Beginn personalisieren, indem er ihn sagen lässt, wo sie jenen Baum dann wiedergetroffen haben. Seltsam daran ist auch, dass das Demonstrativpronomen diesen gewissermaßen suggeriert, dass es ein einzelner – und nicht der Typ Baum – gewesen sei, den sie dann da wieder gesehen haben, was einer völlig unglaubhaften Besonderheit gleichkäme. Als wäre das nicht schon verwirrend genug, lässt Jaeger den Erzähler noch einen weiteren südamerikanisch klingenden und seinen Bezug dabei im Unklaren lassenden Namen einführen. Er spricht nämlich von Gua Guajana Guajana Heißendem, ohne zu klären, was es sei. Hieß der Ort so, an dem sie jenen Baum „wiedergetroffen“ haben oder der Baum selbst? Es wäre seltsam, aber für diese Erzählung nicht ungewöhnlich seltsam, wenn er sie in einer Expedition zum Zwecke der Erforschung des Kakaobaums einen Baum „wiedergetroffen“ zu haben meinte, der einen Namen trug, der noch mit keiner Silbe erwähnt wurde. Und es würde zum Profilierungsdrang des Erzählers passen, wenn er einen einheimischen Namen einer Region einführen würde, um davon abzulenken, dass er über den eigentlichen Forschungsgegenstand nichts berichten konnte. Dass er diesen Namen dann als Landnamen übersetzt, spricht für die zweite Deutung, wenngleich der Bezug des Pronomens es bis vor dieser Übersetzung objektiv unklar ist und da schon zu klären gewesen wäre. Der Absurdität die Krone auf setzt Jaeger schließlich damit, wie er den Erzähler den Landnamen übersetzen lässt: Er bedeute übermorgen in einem Land, das sich in einem Zeitraum befinde, der zwischen zwei Zeiträumen – nämlich, gestern und morgen – liege, die vor übermorgen liegen.



Kommentare